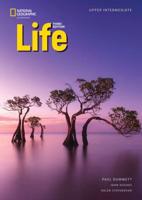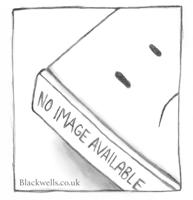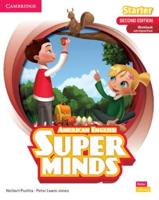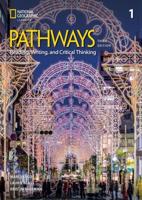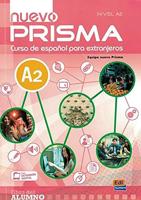Publisher's Synopsis
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Skandinavistik, Note: 2,3, Humboldt-Universit�t zu Berlin (Nordeuropa-Institut), Veranstaltung: UE Schwedische Fl�chtlingspolitik im und nach dem 2. Weltkrieg, 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Nach der Macht�bernahme Hitlers 1933 begannen in Deutschland systematisch �bergriffe auf politisch Andersdenkende und die j�dische Bev�lkerung. Auch die politischen Gegner des NS-Regimes wurden verfolgt und verhaftet, die illegale politische Arbeit immer schwieriger. Vielen blieb als einziger Ausweg nur noch die Flucht. Insgesamt sahen sich nach 1933 etwa 500.000 Menschen dazu gezwungen, Deutschland, �sterreich und das Sudetenland zu verlassen, etwa zehn Prozent von ihnen waren politische Fl�chtlinge, w�hrend die �brigen 90 Prozent von der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung betroffen waren. Nach Ausbruch des Krieges erwies sich das neutrale Schweden neben der Schweiz und Gro�britannien als eines der letzten L�nder, in denen Exilanten Zuflucht finden konnten. Dabei wurde diese Zufluchtsst�tte oftmals zu einem weiteren Ort der Auseinandersetzung mit dem Schicksal als Fl�chtling, denn die Devise der protektionistischen Fremdenpolitik Schwedens hie� 'Schweden den Schweden'. Hierbei galt es nicht nur den gespannten Arbeitsmarkt, sondern auch die 'schwedische Rasse' vor einer drohenden �berfremdung zu sch�tzen. Vor allem Juden und Kommunisten aus Osteuropa und Deutschland wurden dabei als Bedrohung angesehen. Eine Verf�gung vom 16. Februar 1940 erm�glichte schlie�lich die Einrichtung von Lagern, in denen ab M�rz 1940 nicht nur Kommunisten sondern auch andere 'unbequeme' Fl�chtlinge interniert wurden. Paradoxerweise galt der Vorwand der Schutzhaft: sowohl die schwedische Bev�lkerung sollte vor den Inhaftierten - mehr noch - die Inhaftierten vor dem Zugriff der deutschen Beh�rden gesch�tzt werden. Mit der Situation deutscher Internierter in schwedischen Internierungslagern soll sich diese Arbeit