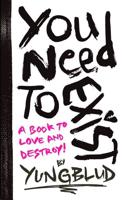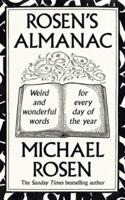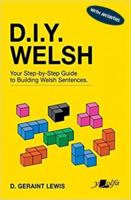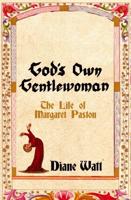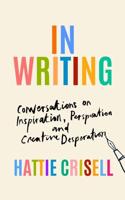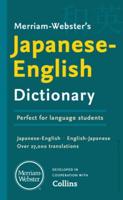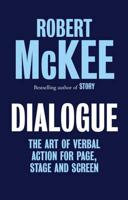Publisher's Synopsis
Zwischenprüfungsarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Germanistik - Sonstiges, Note: 1,0, Universität Potsdam (Institut für Germanistik), Veranstaltung: Wie Worte wirken -, Sprache: Deutsch, Abstract: Jedes wissenschaftliche Werk, jeder juristische Kommentar und jede bundesamtliche Verlautbarung sind darauf angewiesen, dass der Leser versteht, wovon genau gesprochen wird. Dazu stellen die meisten Veröffentlichungen Definitionen der benutzen Termini an den Anfang des Textes, um klar abzugrenzen, was gemeint ist und - was noch viel wichtiger ist - was nicht gemeint ist. Definitionen bestimmen demnach, was wir uns unter einem Begriff vorstellen, welche Eigenschaften in ihm enthalten sind oder welche Funktionen er erfüllt. Dabei sind sie auf eine klare Sprache angewiesen, die Doppeldeutigkeiten vermeidet und sich klar von anderen Wortlauten abgrenzt. Gerade im Berufsfeld der Juristerei können unterschiedliche Auslegungen eines Terminus zu unterschiedlichen Urteilen "im Namen des Volkes" verhängt werden. Stimmen Begriffsdefinitionen der Anklage und der Verteidigung nicht überein, können beide Seiten eine Tat unterschiedlich auslegen. Ein Gelddiebstahl in etwa ist erst dann gegeben, wenn der Eigentümer auch der Gewahrsamsträger ist, während das selbe Delikt, also die unrechtmäßige Entwendung von Geld, ein Betrug ist, wenn der Bestohlene der Vermögensinhaber ist. Es sind also Unterschiede der Merkmale, die einen Begriff erst definieren. Besonders in Bundesagenturen und Ämtern finden sich juristische Texte, die sprachlich zwar sehr präzise, aber dennoch scheinen, außerhalb der vernünftigen Welt zu stehen. So bestimmt die Bundesagentur für Arbeit: "Welches Kind bei einem Elternteil erstes, zweites, drittes oder weiteres Kind ist, richtet sich nach der Reihenfolge der Geburten. Das älteste Kind ist stets das erste Kind." Der Leser fragt sich an dieser Stelle, warum die BAA es für nötig erachtet, diese offensichtliche Tatsache genau zu definieren. Eine Antwort konnte bislan