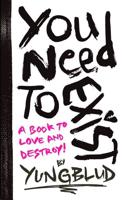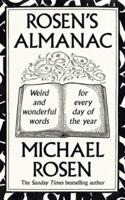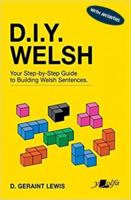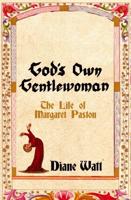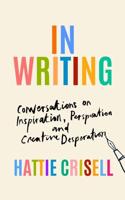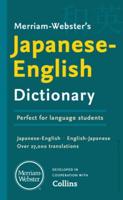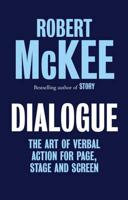Publisher's Synopsis
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Germanistik - Didaktik, Note: 1,0, Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main (Institut fur Deutsche Sprache und Literatur), 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die deutschen Modalverben treten oft in linguistischen Diskursen auf. Es beginnt schon bei ihrer Aufzahlung, und so ist es in der Fachliteratur noch umstritten, ob diese auf die meist genannten sechs zu begrenzen sind: mogen, wollen, sollen, konnen, mussen, durfen. Brunner und Redder fuhren in ihrer Arbeit Argumente auf, dass mindestens auch "mochten," "nicht brauchen" und "werden" hinzugerechnet werden sollten: " 'mochten' hat sich historisch aus dem Prateritoprasentium1 'mogen' entwickelt und kann in dieser Konjunktivform als eigenstandiges Verb betrachtet werden. Es ersetzt 'mogen', das modal nur noch auf wenige Verwendungen beschrankt vorkommt. 'brauchen' kommt als Modalverb nur (teil-)negiert vor, d.h. mit Negation oder mit einschrankenden Ausdrucken wie 'nur', 'kaum' etc. 'werden' ist nur mit Infinitiv modal."2